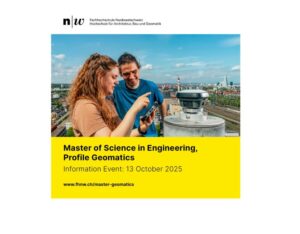Der Handel auf dem Gebiet der heutigen Schweiz war während Jahrhunderten umständlich und teuer. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts gab es mehr als 400 Zollstationen: an Kantonsgrenzen, an Brücken, an Stadttoren. Jedes Mal mussten die Kaufleute auf die transportierten Waren Zoll zahlen, wenn sie an einer solchen Station vorbeikamen. Trotz der Klagen der Kaufleute blieben alle Versuche, die Zölle innerhalb der Eidgenossenschaft abzuschaffen, erfolglos. Stets scheiterten entsprechende Vorhaben am Widerstand einzelner Kantone. Vor allem Uri, Wallis, Graubünden und Tessin, die wesentlich vom Handel lebten, wehrten sich gegen eine Aufhebung der Zölle. Die Zolleinnahmen machten je nach Jahr 50 bis 90 Prozent der kantonalen Einnahmen aus. Darauf konnten und wollten die Kantone, die souverän waren, nicht verzichten.
Mit der Gründung der modernen Schweiz 1848 wurden schliesslich sämtliche Binnenzölle abgeschafft. Allerdings gaben die Kantone ihren Widerstand erst auf, nachdem in der Bundesverfassung festgehalten wurde, dass der neu geschaffene Bund die Kantone für die wegfallenden Zolleinnahmen entschädigt. Mit der Aufhebung der kantonalen Zölle entstand ein zollfreier Binnenmarkt. Dies vereinfachte den Handel massiv und begünstigte den wirtschaftlichen Aufschwung in der Schweiz. Wenig später kam die Vereinheitlichung der Schweizer Währung hinzu, die dem innerschweizerischen Warenaustausch zusätzlich Auftrieb verlieh.